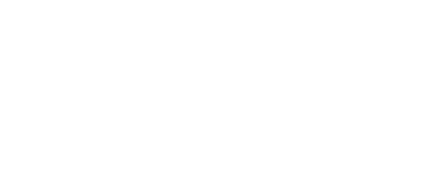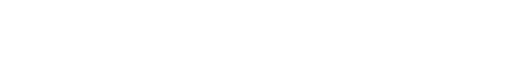Sehr schön gemachte Vignette in der Tat! Gewitzt eingesetzte Folien und Tüten sind immer willkommen. ![]() Dass du vorher noch keinen weiteren Nolan-Film gesehen hattest, ist zwar...unglücklich, aber Interstellar ist kein schlechter Anfang
Dass du vorher noch keinen weiteren Nolan-Film gesehen hattest, ist zwar...unglücklich, aber Interstellar ist kein schlechter Anfang ![]() . Und deinen Ausführungen zum Soundtrack kann ich mich nur anschließen, eine von Zimmers besten und einzigartigsten Arbeiten.
. Und deinen Ausführungen zum Soundtrack kann ich mich nur anschließen, eine von Zimmers besten und einzigartigsten Arbeiten. ![]()
Beiträge von Rauy
-
-
Oh, das wäre in der Tat super! Die Kamera habe ich schon (kann sie auch empfehlen). Ich war schon dabei, sie mit YgrekLego gegen einen Drachen zu tauschen, aber der Tieflader wäre wirklich der Knaller.

-
Auch von mir vielen Dank and die Organisatoren für eines der besten Bauevents des gesamten Jahres und Gratulation an die verdienten Gewinner! Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Bei mir war zwar gegen Ende wieder etwas die Luft raus, aber umso mehr freue ich mich, es trotzdem noch in die Top10 geschafft zu haben. Aber auch ohne eigene Teilnahme ist es einfach ein großartiges Spektakel zu verfolgen. Sehr schön, dass wieder viele neue Teilnehmer dabei waren und es auch einige davon in die Top10 geschafft haben.
-
Meine Kreation für das Thema "Fokus" erscheint zweimal, möglicherweise zu Lasten eines anderen Teilnehmers!
Ich bin mir nicht sicher, warum dies passiert ist, und ich befürchte, dass es unfair gegenüber anderen Teilnehmern und auch nachteilig für mich selbst sein könnte. Wenn die Stimmen auf beide Einträge verteilt werden, verringert sich die Chance, eine hohe Punktzahl zu erreichen.
Thank you for bringing this up. It's not clear how this happened, but I have word from the organizers that this won't be a practical problem. The votes for both entries will just be added up and there hasn't been any other entry that was forgotten instead.

-
Sehr schöne kleine Dioramen und in dem Rahmen echt stilvoll angerichtet, gefällt mir richtig gut! Da will ich auch direkt mal wieder nach London.

-
Wie läuft das bei der Anmeldung von Modellen für die Roguebricks Ausstellungsfläche? Muss man da Fläche seperat angeben? Stelle sonst nur alleine aus, da muss ich nicht um andere rumplanen und buche halt immer meine 2-6m (BB aber tendentiell weniger da ich nur nen kleineres Auto zur Verfügung haben werde, schätze aktuell max 2m)
Du kannst beim Anmelden der konkreten MOCs auswählen, ob sie Teil eines Gemeinschaftsprojekts sind. Da sollte dann in der Liste der RogueBricks-Gemeinschaftstisch mit auftauchen. Musst dann nur irgendwann, also wenn quasi alles angemeldet ist und spätestens wenn die Anmeldung geschlossen ist, noch den Platzbedarf den Rogue-Organisatoren mitteilen (am besten direkt hier in diesem Thread).
-
So, bin jetzt auch angemeldet und freue mich drauf!
 Ich würde auch wieder an beiden Rogue-internen Abendveranstaltungen teilnehmen und natürlich auch auf der Gemeinschaftsfläche. Weiß noch nicht genau mit was, aber sicher ein paar kleine Häuser, wohl aber weniger als letztes Jahr.
Ich würde auch wieder an beiden Rogue-internen Abendveranstaltungen teilnehmen und natürlich auch auf der Gemeinschaftsfläche. Weiß noch nicht genau mit was, aber sicher ein paar kleine Häuser, wohl aber weniger als letztes Jahr. -
Bei so einem langen Wettbewerb geht es doch letztlich hauptsächlich um eines: die Hoffnung, auf einem der vorderen Plätze zu landen. Ist doof, wenn einem diese dann vorab genommen wird.
Zunächst mal würde ich dir durchaus zustimmen, dass diese Halbzeit-Bestenliste eigentlich nicht unbedingt nötig ist und tatsächlich etwas demotivieren kann, weswegen es wohl eben auch nur die besten 10 statt alle sind. (Bei mir war's zwar umgekehrt und ich war eher überrascht, dass ich tatsächlich den tollen 3-in-1-LKW gewinnen könnte, wenn ich das ganze "ernster" nähme.)
Aber das obige Statement würde ich so nicht unterschreiben. Ich finde, bei nahezu allen Bauwettbewerben geht es (mir zumindest) eher darum, ein Thema (und zeitlichen Rahmen) zum bauen zu haben mit dem man gleichzeitig zu einem gemeinschaftlichen Event beitragen kann. Das mag etwas kitschig klingen, aber der olympische Gedanke "dabei sein ist alles" steht für mich da tatsächlich im Vordergrund, weshalb ich auch "öffentliche" Bauwettbewerbe schätze, wo man alle Beiträge zu jeder Zeit gesammelt einsehen kann und sich daraus dann ein großes Gesamtbild des Ereignisses ergibt. Und da kommt es mir vor allem auch drauf an, dass ich mit dem gebauten zufrieden bin (und wenn mir nichts einfällt, was ich Lust hätte zu bauen, dann lass ich es lieber als auf Krampf was rauszuhauen um nicht 0 Punkte zu kriegen). Man könnte auch sagen, dass einem ja mit jedem großartigen Beitrag der anderen quasi ein Stück Hoffnung genommen wird.

Sicher sagt sich das jetzt vielleicht leicht, wenn man in den Top-10 und es ist überhaupt nichts verwerflich daran, auch (oder gar vor allem) durch den kompetitiven Charakter und die Hoffnung eines guten Platzes motiviert zu sein, es ist ja schließlich ein Wettbewerb (und es gibt tolle Preise, die ja auch motivieren sollen). Aber es gibt eben auch genug Wettbewerbe, wo sich die gleichen Master Builder mehr oder weniger die Klinke in die Hand drücken und würde ich da nur dran teilnehmen mit der Hoffnung auf einen guten Platz, würde ich es wohl lieber gleich lassen, so realistisch muss man dann schon auch sein. Aber das sind eben auch die großen Wettbewerbe, wo das verfolgen der vielen tollen Beiträge (die eben auch meist besser sind als der eigene) besonders viel Spaß macht, so wie das beisteuern des eigenen kleinen Anteils zu diesen. Und ehrlicherweise bin ich auch jedes mal bei den Rogue Olympics positiv über die Platzierung überrascht (während ich im ersten Jahr irgendo in der unteren Hälfte/Drittel war) und wer weiß, ob du nicht direkt auf Platz 11/12/13 bist.
Grundsätzlich verstehe ich aber, dass das Mysterium um die tatsächliche Platzierung auch bis zuletzt spannend gehalten werden könnte.
-
Und bevor ich es vergesse: Wärend der Konstruktion der Torso-Segel stellte ich mir die Frage, ob ein Oberkörper, bei dem die Arme ganz regelkonform dran sind, aber eine oder beide Hände fehlen, als ein Teil oder als drei Teile (Torso + zwei Arme) gewertet werden würde.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sobald du ein Teil aus dem Torso entfernst, zählt er direkt als 5, abzüglich der entfernten Teile. Insofern war es gut, dass du vorsorglich alle ganz gelassen hast.
In jedem Fall aber ein klasse Beitrag! Hab es direkt erkannt, obwohl ich wohl 20 Jahre kein Warcraft gespielt habe. Schön...äh...chaotisch gebaut auch.

-
Vor knapp einem Monat ging der Marchitecture-Wettberwerb mit ganzen 64 Einreichungen von 37 Teilnehmern zuende. Dabei verteilen sich die Beiträge genau halbe-halbe auf physische und digitale. Zwar war die reale Kategorie mit 55 Beiträgen aus 5 Kontinenten deutlich beliebter, aber auch die 9 Beiträge in der fiktionalen Kategorie verteilen sich sehr breit auf Filme, Serien, Videospiele und Bücher. Zur geografischen Übersicht über alle Beiträge der ersteren Kategorie habe ich auch diese Google-Karte erstellt. Und zur Übersicht über alle Beiträge insgesamt gibt es folgende Collage, in der auch alle Beiträge entsprechend verlinkt sein müssten, wenn man sie sich auf Flickr anschaut:
Aber kommen wir schließlich zu den Ergebnissen des Bauwettbewerbs! Mit tatkräftiger Unterstützung der Rogues Justus, Kevin J. Walter und Larsvader haben wir alle Beiträge bewertet und die jeweils besten 2 Beiträge der 3 Kategorien bestimmt.
In der Kategorie "Reale Architektur" wären das zum einen Toltomeja mit Antoni Gaudís Casa Batlló und Joël Jurg (ancientlegobricks) mit einer Rekonstruktion des Diokletianspalastes im heutigen Split:
Die Kategorie "Fiktionale Architektur" entschieden Matthias Bartsch (mbmocs) mit Prinzessin Peach's Schloss aus Super Mario 64 für sich, sowie Math Wizard mit Minas Tirith aus LotR:
Bei den digitalen Beiträgen waren die Gewinner ThomasH mit dem Flagler College in St. Augustine, Florida und Sébastien Houyoux (sebriicks) mit dem Petersdom im Vatikan:
Zuletzt bleibt mir zu sagen, dass ich selbst extrem viel Freude an dem Bauwettbewerb hatte, von der gesamten Vorbereitung, dem Bau der Preise und kleinen Promo-Builds, über das Verfolgen der vielen Beiträge während des Wettbewerbs, bis hin zur Bewertung und Aufbereitung. Aber ich bin auch sehr glücklich, um nicht zu sagen überrascht, wie gut es insgesamt ankam und wie viele tolle Beiträge am Ende zusammenkamen. Es besteht die nicht geringe Möglichkeit, dass ich in 10 Monaten versuche, das zu wiederholen.

Bedanken möchte ich mich zum einen natürlich bei den vielen Teilnehmern, ohne deren Beiträge der Wettbewerb ja nix wäre, aber auch bei den Leuten, die mich bei der Organisation unterstützt haben, wie die oben genannten Preisrichter, dbodky und seiner Bewertungsplatform und nicht zuletzt RogueBricks selbst, die ja auch einige der Preise bereitgestellt haben, sowie im speziellen rolli, der mit seiner Erfahrung in Sachen Wettbewerben auch mit Rat und Tat bereit stand.
-
Sorry für die vielen Bilder*.
Da gibt's nichts zu entschuldigen, denn so viele (geschweige denn gute) Bilder hab ich auf der BB auch nicht machen können und all die interessanten und gewitzten Bautechniken begeistern einfach und fangen dieses Kleinod des Historismus dabei perfekt ein. Ein wahrhaft großartiges und beeindruckendes Modell!

-
Thema
Schöpfungen des Verstandes
Ich hatte mich eigentlich schon damit abgefunden, diese Woche mal auszusetzen. Das Thema bietet zwar eigentlich viele Möglichkeiten, aber alles was mir einfiel, ließ sich nicht wirklich realisieren. Doch dann fiel mir gestern abend beim sinnieren auf dem Balkon doch noch etwas anderes ein, als ich mich so in meinem Verstand in anderen Welten verlor. Also habe ich jemanden gebaut, der eine ganze Welt in seinem Verstand ersinnt. Dem geneigten RogueBricks-Mitglied (oder Internetbewohner) wird… Rauy
Rauy28. April 2024 um 23:42 -
Ich hatte mich eigentlich schon damit abgefunden, diese Woche mal auszusetzen. Das Thema bietet zwar eigentlich viele Möglichkeiten, aber alles was mir einfiel, ließ sich nicht wirklich realisieren. Doch dann fiel mir gestern abend beim sinnieren auf dem Balkon doch noch etwas anderes ein, als ich mich so in meinem Verstand in anderen Welten verlor. Also habe ich jemanden gebaut, der eine ganze Welt in seinem Verstand ersinnt. Dem geneigten RogueBricks-Mitglied (oder Internetbewohner) wird dabei auffallen, dass es sich dabei um eine direkte Hommage an MGibarian und sein großartiges Andarstroem-Projekt handelt. Mit der ganzen Fotokomposition bin ich zwar nicht übermäßig zufrieden, aber es wurde halt auch mal wieder spät heute.

I actually made my peace already with not building anything this week. While the topic should offers many possibilities, anything that came to my mind was rather impossible to realize. But when letting my mind wander to other worlds on saturday evening, I had another idea. I built someone dreaming up an entire world in his mind. RogueBricks members (or internet citizens in general) might recognize that it is a direct homage to MGibarian and his wonderful Andarstrœm project. I'm not all too satisfied with the overall photo composition, but it was quite late again this sunday.

-
Hui, der ist aber klasse geworden!
 Ich habe mir das Spiel auch erst vor etwa über einem Jahr erschlossen. Ich kann dir zwar auch nicht genau sagen, wie viel Verstand die Maschinen und speziell der Tallneck haben, aber gänzlich ohne kommen sie natürlich nicht aus. Insofern ist das sicher nicht die schlechteste Interpretation des Themas.
Ich habe mir das Spiel auch erst vor etwa über einem Jahr erschlossen. Ich kann dir zwar auch nicht genau sagen, wie viel Verstand die Maschinen und speziell der Tallneck haben, aber gänzlich ohne kommen sie natürlich nicht aus. Insofern ist das sicher nicht die schlechteste Interpretation des Themas.  Und es erinnert mich direkt an einen Rogue Olympics Beitrag aus dem letzten Jahr:Thema
Und es erinnert mich direkt an einen Rogue Olympics Beitrag aus dem letzten Jahr:ThemaHorizon Zero Dawn: The Thunderjaw
Wild? Was ist denn wild? Dinos sind wild... und Roboter natürlich! Die Idee, eine "Maschine" aus Horizon Zero Dawn zu bauen, war schnell geboren. Schwierigkeit hierbei: Ich habe das Spiel bis heute nie spielen können und habe nur durch das LEGO Set einen Bezug dazu . Erstmal musste also recherchiert werden...
. Erstmal musste also recherchiert werden...
roguebricks.de/index.php?attachment/9612/
Google war mein Freund und Helfer... Diese Militärroboter haben sich wohl irgendwann mal wegen eines Programmierfehlers gegen die Entwickler… Justus
Justus25. April 2023 um 22:41 Als Ergänzung zum wilden Thunderjaw passt der eher sanftere und auf verständigere Kommunikation optimierte Tallneck doch geradezu perfekt!
-
Hah! Immer wieder toll, was für verrückte Assoziationen die Leute mit den Themen haben.
 Auf jeden Fall schön in Szene gesetzt und ja, wenn man's einmal weiß, ist "mind the gap" ja schon fest in der britischen Kultur verankert.
Auf jeden Fall schön in Szene gesetzt und ja, wenn man's einmal weiß, ist "mind the gap" ja schon fest in der britischen Kultur verankert.  Ich bin auch noch in Schockstarre von dem Thema, obwohl bei "Verstand" ja eigentlich so viel gehen müsste.
Ich bin auch noch in Schockstarre von dem Thema, obwohl bei "Verstand" ja eigentlich so viel gehen müsste. 
-
And the chests are back!
 Really efficient use of parts and space with those "clouds".
Really efficient use of parts and space with those "clouds". 
-
Heh, großartig umgesetzt!
 Ja, das bringt Erinnerungen, bei mir war's haupsächlich mein Cousin, mit dem ich das gepielt habe. Wir haben das vor nicht allzu langer Zeit aber tatsächlich mal wieder auf seiner Switch ausgegraben und es macht nach wie vor riesen Spaß, mit den kleinen Würmchen durch die Gegend zu ballern!
Ja, das bringt Erinnerungen, bei mir war's haupsächlich mein Cousin, mit dem ich das gepielt habe. Wir haben das vor nicht allzu langer Zeit aber tatsächlich mal wieder auf seiner Switch ausgegraben und es macht nach wie vor riesen Spaß, mit den kleinen Würmchen durch die Gegend zu ballern! 
Und ja, ich nehme auch manchmal Sets auseinander wegen einem Teil, aber wichtiger ist, dass man nicht vergisst, wo man was geklaut hat und sich dann Monate später wundert, wieso da ein Teil fehlt. Aber generell bin ich auch großer Verfechter kurzfristiger BrickLink-Bestellungen. Wenn man früh eine Idee hat und sich auf Deutschland beschränkt, wird man von den Lieferzeiten selten enttäuscht. Aber ich kauf, wenn's knapp wird und ich keine Kompromisse eingehen will, auch mal ein ganzes Set bei Amazon für ein-zwei Teile.

-
PS: Kann mir mal jemand erklären wie ich diese Ausklappbaren Abschnitte erstellen kann?
Das sind sogenannte "Spoiler", da sie klassischerweise dazu dienen, sensible Informationen erst auf Knopfdruck preiszugeben, etwa für informationsängstliche Nutzer, die nicht wissen wollen, ob Iron-Man bis zum Schluss überlebt. Den Knopf dazu findest du oben in der Editor-Symbolleiste ganz rechts (das durchgestrichene Auge).

Aber schöner Beitrag!

-
Thema
Zu Neuen Grenzen
Diesmal hab ich ein recht klassisches Motiv gebaut, indem ich mich eher auf das englische Thema konzentrierte. Wir sehen zwei Astronauten, wie sie ihrem Schicksal, um nicht zu sagen dem der gesamten Menschheit, entgegentreten. Die Rakete und der Abschussturm basieren direkt auf der NASA Saturn V und den Apollo-Missionen, aber bei den Astronauten habe ich etwas mehr künstlerische Freiheit walten lassen, zum einen, weil zwei Astronauten eine bessere Komposition abgeben als drei, aber auch weil… Rauy
Rauy20. April 2024 um 22:21 -
Diesmal hab ich ein recht klassisches Motiv gebaut, indem ich mich eher auf das englische Thema konzentrierte. Wir sehen zwei Astronauten, wie sie ihrem Schicksal, um nicht zu sagen dem der gesamten Menschheit, entgegentreten. Die Rakete und der Abschussturm basieren direkt auf der NASA Saturn V und den Apollo-Missionen, aber bei den Astronauten habe ich etwas mehr künstlerische Freiheit walten lassen, zum einen, weil zwei Astronauten eine bessere Komposition abgeben als drei, aber auch weil die Herren Aldrin, Armstrong und Collins wohl einfach dreimal den gleichen Kurzhaarschnitt hätten.
 Da lässt sich so etwas mehr Diversität in die Szene bringen. Ich habe auch überlegt, lieber passend zum neuen LEGO-Set die Artemis-Anlage zu bauen, aber die Saturn V gibt einfach die klassischere Farbgebung.
Da lässt sich so etwas mehr Diversität in die Szene bringen. Ich habe auch überlegt, lieber passend zum neuen LEGO-Set die Artemis-Anlage zu bauen, aber die Saturn V gibt einfach die klassischere Farbgebung.This time I built a rather classic motif of two astronauts approaching their fate, which will not only literally uplift them but also uplift humankind forevermore. The rocket and launch tower are based directly on the NASA Saturn V and the Apollo missions, but with the astronauts I used a bit more artistic license because on the one hand two astronauts give a better composition and on the other hand the original Apollo drew would basically have three times the same short haircut.
 So this way we can get a bit mote diversity into the scene. I also considering doing the Artemis launch systems instead, fitting to the new LEGO set, but the Saturn V just gives a more classic colour composition.
So this way we can get a bit mote diversity into the scene. I also considering doing the Artemis launch systems instead, fitting to the new LEGO set, but the Saturn V just gives a more classic colour composition.